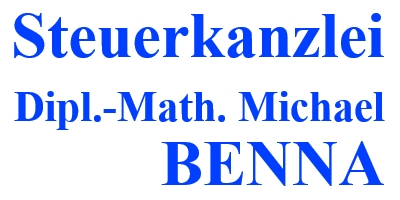 Kontakt:
Kontakt:Bräuhausstrasse 18
84524 Neuötting
Tel.: 08671 / 884860
Fax.: 08671 / 885681
office@steuerberater-benna.de


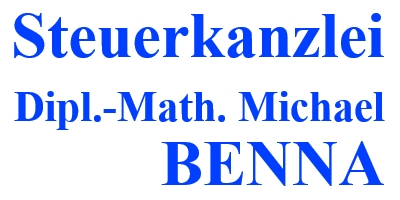 Kontakt:
Kontakt:
Bräuhausstrasse 18
84524 Neuötting
Tel.: 08671 / 884860
Fax.: 08671 / 885681
office@steuerberater-benna.de

Die über einen prüfenden Dritten eingereichten Anträge auf Überbrückungshilfen sowie auf November- und Dezemberhilfen sind häufig auf Basis von Umsatzprognosen und prognostizierter Kosten bewilligt worden. Nach Vorliegen der realisierten Umsatzzahlen und Fixkostenabrechnungen sind alle Antragstellenden zur Einreichung einer Schlussabrechnung über einen prüfenden Dritten verpflichtet.
Seit 15. November 2022 kann die Schlussabrechnung für die Überbrückungshilfe III Plus und Überbrückungshilfe IV eingereicht werden (Paket 2 der Schlussabrechnung).
Auf Grundlage der tatsächlichen Umsatzzahlen und Fixkosten erfolgt ab 5. Mai 2022 bis zum 30. September 2024 (Fristverlängerung!) eine Schlussabrechnung durch die prüfenden Dritten. Nach Prüfung durch die Bewilligungsstelle wird im Schlussbescheid eine endgültige Förderhöhe mitgeteilt. Das kann je nach gewählten Programmen zu einer Bestätigung der erhaltenen Mittel oder zu einer Nach- oder Rückzahlung führen.